 |
|||||||||||||
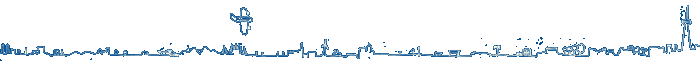
|
|
||||||||
|
Wie ist die Idee entstanden, einen so explizit europäischen Film zu machen? Für mich gehörte es in den letzten Jahren zu den spannendsten Seiten Berlins, dass man hier Menschen aus ganz Europa treffen konnte. Es lag eine bestimmte Aufbruchstimmung in der Luft, eine große Neugier. Das hat mich interessiert. Ich war in dieser Zeit mit meinem Film Berlin is in Germany viel in Europa unterwegs, auf 20 Festivals und zu den Kinostarts in Spanien, Frankreich und der Türkei. Die wesentliche Erfahrung war überall die gleiche: Die Leute haben sich für das interessiert, was der Film über Deutschland und Berlin erzählt, und sie haben das als etwas gesehen, das mit ihnen zu tun hat, als europäische Erfahrung. Mit Freunden aus Spanien, Frankreich, der Türkei oder Russland haben wir uns oft gefragt, wie denn so etwas wie der european way of life aussieht. Darüber wollte ich einen Film machen, über und in Europa, wobei klar war, dass Europa nicht an den Grenzen der Europäischen Union aufhört. War der Film von Anfang an episodisch angelegt? Man kann keinen Film über Europa machen und den Anspruch haben, allem gerecht zu werden. Ich wollte kleine Ausschnitte wählen, ich wollte das Gefühl einfangen, dass etwas da ist, dass etwas entsteht. Bei Berlin is in Germany bin ich von einer Figur ausgegangen – Ein Mann, ein Problem, das war vom Drehbuch her ein klassischer Dreiakter, ein klarer Strich, wenn man so will. Jetzt wollte ich etwas anderes machen, eine Multiplot-Geschichte, keinen Strich, sondern viele Punkte. Mich hat die Möglichkeit interessiert, vielschichtig zu erzählen, die Poesie der kleinen Dinge zu finden. Deshalb wollte ich von Anfang an eine episodische Struktur, die nacheinander erzählt und durch die Gleichzeitigkeit verwoben wird. An dem einen Ort geschieht dieses, am nächsten jenes, am dritten wieder etwas anderes... Das gleichzeitige Nebeneinanderstellen gibt den einzelnen Dingen mehr Bedeutung. Wir erleben die Menschen und ihre Reaktionen in Bezug auf dasselbe Ereignis, in diesem Fall auf ein Sportereignis, das in ganz Europa übertragen wird. Man springt dann bei jedem Ortswechsel sozusagen in der Zeit zurück, bleibt aber bei den einzelnen Geschichten. Interessant war es auch, viermal auf jeweils andere Weise einen ähnlichen Plot zu erzählen... fast wie bei einem Minimal Techno Track, der eine musikalische Figur wiederholt und doch jedes Mal anders ist. Wie kamen Sie auf Fußball als erzählerische Klammer? Ich wollte über die europäische Realität erzählen, nicht über ein Hirngespinst. Fußball ist einfach, und Fußball schaut man überall, Religion hin oder her. Nicht zuletzt ist Europa im Fußball traditionell ja großzügiger definiert als in der Politik. Es ist schwierig, ein anderes kulturelles Ereignis zu finden, das in Europa so wahr genommen wird wie das Championsleaguefinale. Ich habe mich gefragt, was an welchen Orten los wäre, wenn z.B. Galatasaray Istanbul gegen Deportivo La Coruña in Moskau im Championsleaguefinale spielen würde... Ich habe im Jahr 2000 in Berlin Kreuzberg mit den ganzen türkischen Fans erlebt, wie Galatasaray Istanbul Uefa-Cup Sieger wurde. Es war unglaublich... Fußball als erzählerische Klammer, das hatte für mich Poesie. Dadurch entstand ein Bannkreis, der die Städte verbunden hat. Sie bezeichnen Ihren Film als Comédie Burlesque – ein Genre, das eng mit dem Stummfilm verknüpft ist. Welche Rolle spielt die Sprache in Ihrem Film? Sprache ist das Grundthema. Es hat mich interessiert, wie wir heute und
wie wir vielleicht später einmal miteinander reden werden. Was passiert,
wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, welche absurden Situationen können
entstehen? Ich bin von meinen persönlichen Erfahrungen ausgegangen
und dann schnell beim Reisen gelandet, bei Reisenden in Europa. Jeder
kennt das: Man kommt irgendwo an, wird bestohlen oder findet sich sonstwie
wieder in einer blöden Lage. Schon muss man reden, kann die Landessprache
nicht, schon wird es schwierig oder komisch. Diese Momente des Absurden
waren mir wichtig. Und von solchen Momenten lebt die Comédie Burlesque.
Es war für mich ein reizvoller Widerspruch, einen Film über
Sprache zu machen und mich dabei eines Stummfilmgenres zu bedienen. Nach welchen Kriterien haben Sie die vier Städte im Film ausgewählt? Es ging darum, was die Städte über Europa erzählen, welche Symbolik sie haben, um den eigenen Bezug und auch um die Machbarkeit. In Berlin wohne ich in Santiago de Compostela habe ich gewohnt, in Istanbul habe ich Freunde und kenne mich aus, in Moskau war ich ein paarmal. Wenn ich ein Bild von Europa zeichnen will, gehören Moskau und Istanbul für mich dazu. Sie sind das Tor zu Asien, ganz abgesehen von ihrer religiösen und geschichtlichen Bedeutung in Europa. Natürlich vermisse ich Italien, Portugal, Skandinavien... aber der ganze Kontinent ging halt nicht. Deswegen haben wir uns für die äußeren Pole entschieden, die ja auch irgendwie Magneten sind, die anziehen und senden. Natürlich arbeitet der Film viel mit Symbolen, angefangen bei den Fußballvereinen oder dem Umstand, dass Ostberlin und Moskau in manchen Ecken genau gleich aussehen. Manches haben wir erst während der Dreharbeiten so richtig begriffen, z.B. dass in Istanbul und Compostela kein weltliches Gebäude die religiöse Architektur überragt, während es in Berlin und Moskau genau andersherum ist. In der Umsetzung war die Frage wichtig, wie man die Städte einführt, was man zeigt. In Moskau lassen wir die Stadt an Kate vorüberziehen, in Istanbul haben wir uns bewusst für die europäische Seite der Stadt entschieden. In Santiago war es mir wichtig, die Idee der Region hervorzuheben. Die Einheimischen dort reden zum Beispiel gar kein Spanisch, sondern Gallego, was dem Portugiesischen ähnelt. Überhaupt finde ich die Idee eines Europa der Regionen wichtig. Der große Unterschied zwischen Celal und Rokko ist, dass der eine aus Schwaben und der andere aus Cottbus kommt; bei dem französischen Pärchen stammt sie aus Paris, er aus Marseille... Es greift zu kurz, nur Länder zu sehen. Berlin ist eine Stadt, wo alles zusammenkommt, wo Ost und West wie vielleicht nirgendwo sonst aufeinanderprallen. Hier kam es uns auf die Gegensätze an, Hohenschönhausen, Kreuzberg... Entscheidend war immer der Blickwinkel der Protago-nisten: Wie würden sie die Stadt sehen? Wie sieht man einen Berliner Außenbezirk, wenn man an die Banlieus in Paris gewöhnt ist? Sie haben davon gesprochen, die Geschichten ‚einfach‘ zu halten. Was meinen Sie damit? Einfachheit meint, dass eine klare Situation, ein Kontext für die Schauspieler und die Bilder hergestellt wird. Ich wollte nicht diesen existentiellen Plot wie bei Berlin is in Germany. Die Herausforderung lag jetzt darin, das Alltägliche spannend zu machen und in jeder Szene Europa drin zu haben. Dazu kommt, dass die Details immer wichtiger werden, wenn man vier Geschichten mit dem gleichen Aufhänger erzählt. Sonst funktioniert es nicht. Ich wollte einen Schauspielerfilm, einen Bilderfilm. Ein starker Plot erdrückt manchmal den Film und die Schauspieler. Deshalb haben wir den Plot bewusst einfach gehalten – übrigens auch wegen der Sprachenvielfalt im Film und der produktionstechnischen Umsetzung. Alle Figuren haben ein klares Ziel: Sie möchten einen Raub melden oder ein Papier von einer Polizeidienststelle. Die Spannung stellt sich her, indem der Zuschauer immer mehr weiß als die Figuren. Wir wissen, dass Rokko, Rachida oder Claude lügen, Gabor die Wahrheit sagt, die Polizisten wissen es nicht. Jede der Geschichten erzählt vom Allgemeinen ins Spezielle, vom Makro- zum Mikrokosmos. Zuerst sehen wir die Schauplätze in der Totalen, aus dem Blickwinkel der Helden. Dann reisen wir ins Spezielle und enden auf einer Polizeiwache, in der dramatischen Situation, vor den Autoritäten eines fremden Staates zu stehen. Für die Filmsprache heißt das, von der Distanz, der Totalen oder Halbtotalen, zur Überhöhung der Großaufnahme zu gehen, vom fast Dokumentarischen ins Subjektive. Welche dramaturgischen Herausforderungen stellt ein Episodenfilm? Entscheidend ist, dass alle Geschichten für sich selbst stehen, zusammen aber einen Film ergeben müssen, den man als Einheit wahrnimmt. Dafür waren unsere Klammern wichtig, Europa, Fußball, die Gleichzeitigkeit. Ich gehe immer vom Realismus aus. Wenn die Klammer realistisch funktioniert, dann wird auch das Ganze funktionieren. Der Film geht von diesem Realismus aus und wird dann von Episode zu Episode immer absurder. Der Moskau-Teil leistet viel Aufbauarbeit und setzt die Situation des Gepäckdiebstahls und seiner Konsequenzen. Hier geht es vor allem um Nicht-Kommunikation, um das Fehlen einer gemeinsamen Sprache, um west meets east. Istanbul steht für das Gegenteil, die Protagonisten können sich verbal verständigen, treffen aber auf eine ungewohnte Situation – germans in the orient. In Santiago geht es um den Pilger und den Einheimischen, um die Missverständnisse, die aus den Mentalitätsunterschieden der Helden und ihrem Spanglish-Kauderwelsch entstehen. In Berlin treffen schließlich ganz verschiedene Hintergründe, Sprachen, Kulturen aufeinander, die excepcion culturelle als Normalzustand. Wir haben die Episoden so angelegt, dass sie in einer bestimmten Weise aufeinander aufbauen. Später im Schnitt haben wir versucht, diese Gesamtdramaturgie weiter zu akzentuieren. Wobei es, bei aller Sorgfalt in der Konzeption, immer darauf ankommt, das dann spielerisch umzusetzen, ohne Dogma. Zu welchem Zeitpunkt standen die Schauspieler für die Hauptrollen fest? Einige Schauspieler standen von Anfang an fest, für die habe ich geschrieben. Miguel de Lira, den ich aus meiner Zeit in Santiago de Compostela kenne, hat das Projekt von Anfang an begleitet und auch den Kontakt zum spanischen Koproduzenten Antón Reixa ermöglicht. Erdal Yildiz, Nuray Sahin und Florian Lukas hatte ich von Anfang an im Kopf, ebenso Boris Arquier, den ich aus seiner Zeit bei Nouveau Cirque-Gruppen wie Archaos und Gosh kenne, Rachida Brakni, die ich in Chaos von Colline Serreau gesehen hatte... Viele der Figuren im Buch sind auf bestimmte Schauspieler im Kopf hin entwickelt und wurden dann mit den Schauspielern verfeinert. Das Casting habe ich wie bei meinen vorherigen Filmen mit Karen Wendland gemacht, die ein hervorragendes Gespür für Geschichten und Gesichter hat. Da jede Geschichte auch von der lakonischen Komik lebt, sollten die Schauspieler einen bestimmten, sozusagen länderspezifischen Humor mitbringen. Wir wollten Situationskomiker, die in kleinen Gesten ganze Galaxien aufzeigen und große Absurditäten mit kleiner Geste und Humor erzählen können. Und wir wollten die ganz verschiedenen Gesichter Europas. Der asiatisch aussehende, turkmenische Beamte und seine blauäugige Kollegin in Moskau, der Südfranzose und die algerische Pariserin, Erdal Yildiz und Nuray Sahin, die aus Ostanatolien kommen und fast persisch aussehen. Gesichter erzählen etwas durch sich selbst. Wie arbeiten Sie mit den Schauspielern, gibt es detaillierte Vorgaben, proben Sie vor den Dreharbeiten? Die eigentliche Hauptarbeit mit den Schauspielern liegt für mich vor dem Drehen. Im Drehbuch und im Storyboard versuche ich die Festlegungen zu treffen, die den Schauspielern oder dem Kameramann später die Möglichkeit zu Variationen und Abweichungen geben. Mit den acht Hauptdarstellern haben wir vor den Dreharbeiten geprobt. Dabei verändert sich immer viel, es kommt immer etwas dazu. Der Regisseur definiert den Raum, die Schauspieler füllen ihn aus, sie müssen spielen... und dieses letzte Geheimnis verkörpern, das man nie ergründen kann, wenn Menschen aufeinander treffen. Das Drehen auf Cinemascope war für die Schauspieler eine große Herausforderung, weil das große Format eine starke Festlegung und große Präzision er-fordert. Gleichzeitig sollte das Spontane nicht verloren gehen. Dadurch, dass wir aus der Probenarbeit wussten, worum es in den Szenen, im Spiel gehen sollte, war es wieder möglich zu im-provisieren. Improvisation bedeutet ja nicht, dass man einfach drauflos probiert, sondern etwas immer wieder neu zu gestalten. Beim Drehen geht es dann um die Feinheiten, um die Möglichkeiten, den Schauspielern einen Freiraum zu schaffen. Der Regisseur am Set ist dann mehr eine Art Moderator, der die Anforderungen, die vom Ton oder der Kamera oder der Ausstattung kommen, den Schauspielern erklären kann. Weshalb haben Sie im aufwendigen Cinemascope-Format gedreht? Florian Hoffmeister und ich haben versucht eine Filmgrammatik zu entwickeln, die den Zuschauer mit den Helden mitreisen lässt... Eine Reise durch das sich verändernde Europa, aus dem spezifischen Blickwinkel der Helden. Die Städte und Landschaften werden selbst zu Hauptdarstellern. Deshalb war uns Cinemascope wichtig. Wir wollten die Totalen mit dem vollen Blendenumfang, wir wollten einen Film der komponierten Bilder. Wir wussten von vornherein, dass Cinemascope durch den notwendigen größeren Aufwand an Licht und Equipment eine gewisse Unflexibilität beim Drehen bewirken würde. Das haben wir in der Vorbereitung aufzufangen versucht. Die filmische Grammatik war durch die Storyboards festgelegt, sonst hätten wir diesen Höllenritt in vier Wochen durch vier europäische Städte auch nicht hingekriegt. Wie sind die Dreharbeiten in den vier Städten verlaufen? Angefangen haben wir in Santiago, wo ich mich auskannte und die spanische Koproduktion sitzt, was manches einfacher gemacht hat. Moskau im Anschluss war dann die Bergetappe. Das fing damit an, die ganze Technik durch den Zoll zu bringen, ein echtes Husarenstück der Produktionsleiterinnen Maren Wölk und Simone Arndt... Andere Dinge waren dann wieder ganz einfach, wie die Autobahnsper-rung, ein Polizeiauto vorne, eines hinten, quergestellt, fertig. Und die Russen wissen, was Kino ist... Die Techniker zum Beispiel, waren alle super. Das Team in Istanbul war sehr gut aufgestellt, z. B konnten dort alle sehr gut englisch. Als wir in Kumkapi drehen wollten, haben sie sich erstmal an den Kopf gefasst, das sei viel zu gefährlich dort... Aber letztlich war genau das eine tolle Erfahrung, die Leute in Kumkapi haben uns toll aufgenommen und unterstützt. Schwierig wird es natürlich, wenn man einem Fenerbahce Fan, eine Galatasaray Fahne vor das Fenster hängt... Es war interessant zu sehen, dass es einen echten Austausch gab, zwischen den verschiedenen Teams, den Leuten im Stadtteil, unseren Schauspielern, gerade mit Erdal Yildiz oder Nuray Sahin. Die letzte Drehetappe war dann Berlin, das Heimspiel zum Schluss. Insgesamt, muss ich schon sagen, war das Rock’n Roll, was da ablief. Wir mussten im Zeitplan bleiben, wir konnten nichts verschieben, nichts nachholen. Es gab eine unglaubliche Konzentration im Team, das für alle Probleme, die während eines solchen Drehs auftauchen, Lösungen gefunden hat. Dabei hat sich ausgezahlt, dass wir in der Projektvorbereitung immer an die Machbarkeit gedacht haben. Das hat uns die Flexibilität ermöglicht, vor Ort reagieren zu können, auch mit dem Aufwand von Cinemascope. Auch für den Tonmann Frank Kruse war es eine echte Herausforderung, in den verschiedenen Städten zu arbeiten. Städte sind immer laut, und oft haben wir mittendrin gedreht, wie auf der Plaza de la Quintana in Santiago, wo wir nichts absperren konnten... Da einen Originalton hinzukriegen, der die fürs Kino notwendige Breite hat, ist eine echte Leistung. Wir haben durchgängig mit Originalton gearbeitet, wir mussten keinen einzigen Synchron-Take machen. Das war wesentlich für die Dramaturgie der Tonspur, die Unterschiede und Entwicklungen herausarbeiten sollte. Dafür war es wichtig, mit Frank Kruse jemanden dabei zu haben, der als O-Tonmeister und als Sound Designer die Tonebene von der Vorbereitung bis zur Endmischung betreuen konnte. Wie lief die Verständigung am Set, was war die Produktionssprache? Was man für alle Länder sagen kann: die Grundidee des Films wurde überall verstanden, dass es nämlich um Geschichten ging, in der verschiedene Mentalitäten aufeinander prallen. Dafür war in allen Ländern Begeisterung da. Und überall, wo wir hingekommen sind, haben uns die Leute so akzeptiert, wie wir sind. Es gab eine handwerkliche Sprache des Kinos, die uns verbunden hat. Das Zusammenarbeiten mit Schauspielern aus sieben Ländern, mit den verschiedenen Hintergründen und Traditionen, war für mich dabei besonders interessant. Wobei sich auch da gezeigt hat, dass die Schauspielersprache, die Clown-Sprache universell ist. Die konkrete Drehsituation muss man sich dann so vorstellen, dass Gilmar Steinig, der Oberbeleuchter, ein spanisches Team einweisen muss, oder ein russisches, der Kameramann ruft etwas dazwischen, die Schauspieler haben etwas zu fragen... Dieses ganze Sprachenwirrwarr, dieses europäische Gefühl und Durcheinander, um das es in One Day in Europe geht, das haben wir am Set gelebt, mit Händen und Füßen und einer wilden Mischung aus englisch, deutsch und allen möglichen Sprachen. Aber verstanden haben wir uns am Ende immer. Wie sind Sie in der Postproduktion mit der Herausforderung der verschiedenen Episoden umgegangen? Anne Fabini hat schon während der Dreharbeiten das Material am Avid vorgeschnitten. Den ersten Rohschnitt der Spanien-Episode habe ich in Istanbul im Hotelzimmer gesehen, was ziemlich ermutigend war. Anne versteht sehr viel vom Geschichten-Erzählen, und wir kennen uns aus unserer langen Zusammenarbeit so gut, dass dieses parallele Arbeiten hervorragend geklappt hat. Direkt nach dem Drehen haben wir uns dann an den Schnitt gemacht. Ich kann Filme nicht liegenlassen, ich muss in diesem Rausch der Dreharbeiten weitermachen. Parallel zum Schnitt hat Florian Appl an der Musik gearbeitet. Er bringt durch seine Arbeit mit dem Zirkus Gosh ein unglaubliches Repertoire mit, seine Musik hat für mich immer ein gewisses Augenzwinkern... Die Filmmusik und das Sounddesign sind eng miteinander abgestimmt. Während die Tonebene die Aufgabe hatte, Unterschiede deutlich zu machen, sollte die Musik verbinden und Gemeinsamkeiten herstellen. Sie haben bei One Day in Europe mit vielen gearbeitet, die schon bei ihren früheren Filmen mitgewirkt haben. Florian Appl, Anne Fabini, Florian Hoffmeister...Erdal Yildiz, Nuray Sahin, Oleg Assadulim, Arturo Salvador, Miguel de Lira, Boris Arquier, Facundo Diab, Tom Jahn... Über die Jahre lernt man die Stärken und Schwächen der anderen kennen und man weiß, was man zusammen sucht. Das wird dann so etwas wie eine Zirkusfamilie. Wir haben den engen Zeitplan bei One Day in Europe nur geschafft, weil alle Beteiligten einander vertraut haben, angefangen bei den Redakteuren Andreas Schreitmüller und Lucas Schmidt. Es ging allen um diesen Film. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist Filmemachen sehr banal. Dann weiß man, worum es geht, dann sind Sachfragen zu lösen, ohne Eitelkeiten, meistens unter Zeitdruck. Mit meinen Produzentinnen Anne und Sigrid von moneypenny hat das großen Spaß gemacht. Die arbeiten nicht nur sehr diszipliniert und mit viel Elan, sondern auch mit viel guter Laune... Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, ob unser kleines Schiff auch auf die Leinwände Europas segelt. Ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert, in Berlin, Moskau, Santiago, Istanbul...
Presseheft mit Interview als PDF (1.8 MB)
|



